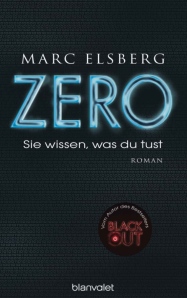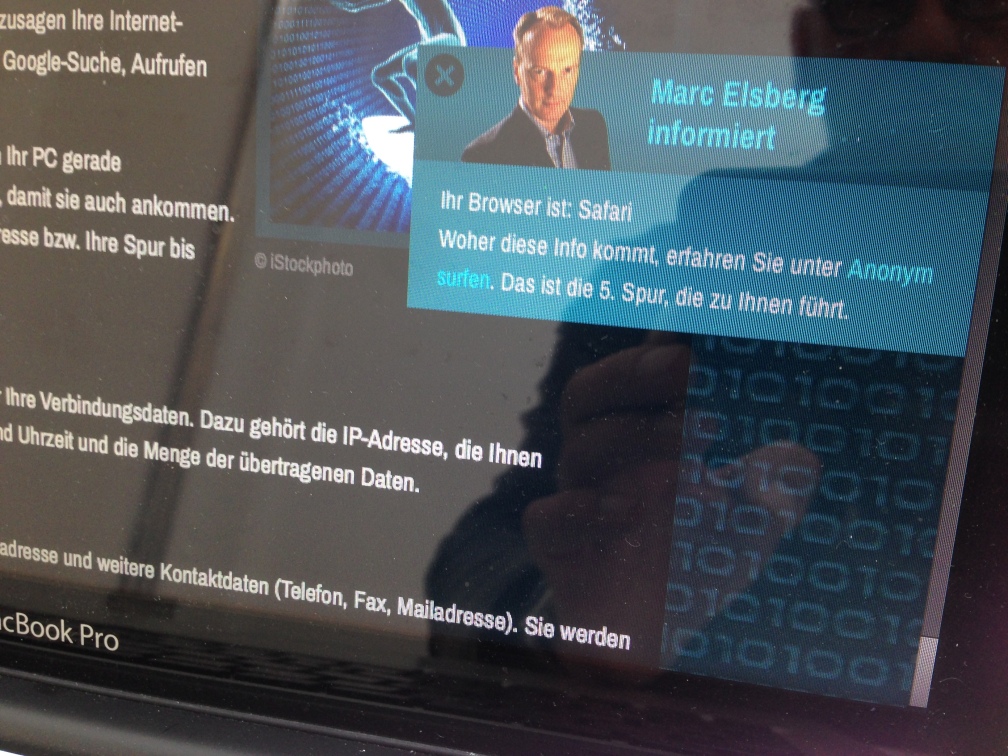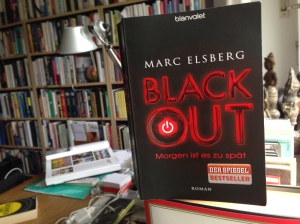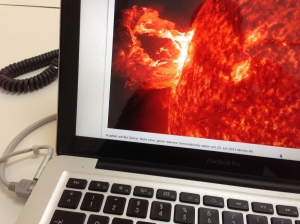Chinareise Teil 1
Eine Masse Mensch, geduckt, im einheitlich ausgebleichtem Look, drängt schweigend durch staubige Straßen eines Großstadt-Molochs, hin zu ihrem Tagwerk, von dem sie erschöpft nach 12 Stunden in eine der Millionen Bienenwaben-Einheitsstätten heimkehren, dort die Schüssel Reisgericht mit Stäbchen löffelnd im schweigenden Kreis der Großfamilie auf einen flimmernden Flatscreen stieren, um den grauen Alltag auszublenden. Demgegenüber eine korrupte Elite, die asozial Millionen rafft und ihren Reichtum protzig in den Metropolen zur Schau stellt.
Über kaum ein Land, das ich bislang bereiste, waren meine unreflektierten Vorstellungen (und Vorurteile) so weit weg von der Wirklichkeit wie von China. Und das, obwohl wir chinesische Freunde haben, die uns im vorvergangenen Jahr in Deutschland besuchten und ich vor Jahren schon geschäftlich intensive Beziehungen zu China hatte. Doch erst jetzt sind wir endlich der Einladung unserer Freunde gefolgt und haben – meine Frau, mein siebenjährige Sohn und ich – eine 14tägige Reise nach China gemacht. Danach kann ich nur sagen: ich bin tief beeindruckt, ziehe den Hut und verbeuge mich ganz tief vor den Leistungen, die die Menschen in diesem Land vollbracht haben und noch vollbringen werden.

Sicher, in 14 Tagen kann man nur wenigen Einwohnern der über 1,3 Mrd. Chinesen die Hand schütteln und zulächeln. Sowieso ist China als „Land des Lächelns“ ein unhaltbares Operetten-Klischee, das wir Franz Lehár verdanken, der keine Ahnung von dem Land hatte, wie schon Christian Y. Schmidt in seinem satirischen China-Crashkurs „Bliefe von dlüben“ bestätigt. Die Chinesen lächeln ähnlich sparsam wie wir, doch dafür lachen sie viel schamloser. Schadenfreude ist nicht verpönt, sondern eine bevorzugte Form eines deftigen Humors. Feinsinnige Ironie und amüsante Witze zählen hingegen nicht zum Repertoire des humorigen Chinesen wenn man Christian Y. Schmidt glauben mag.

Mein Sohn und sein chinesischer Freund Ben lassen mitten in Peking einen Drachen steigen. Eine Leidenschaft unserer Freunde in Peking.
Schmidt lebt seit 2005 in Peking, ist mit einer Chinesin verheiratet und kann sich überhaupt nicht mehr vorstellen, in einem Kleinstaat wie Deutschland zu leben. Sein Buch war ein perfekter Begleiter für unsere Reise, obwohl es – 2009 erschienen – nicht mehr ganz aktuell ist. Eine Deutschlandreportage würde in fünf Jahren sicher nicht all zu sehr an Aktualität verlieren. Doch bei Berichten über China muss man mindestens den Faktor 4 ansetzen. Hier verändert sich in 5 Jahren so viel wie bei uns in 20. Und wenn es um Stadtplanung, Bauten und Infrastruktur geht, kann man den Faktor locker auf 10 erhöhen. In Shanghai, die letzte Station unserer Reise, trafen wir Freunde, die dort geboren sind. Seit 25 Jahren leben sie im Ausland, sind aber regelmäßig in Shanghai. Sie gestanden uns, dass sich ihre Geburtsstadt in den vergangenen 20 Jahren stetig so verändert, dass sie sich alle Jahre neu orientieren müssen. Und das in einer 25 Mio. Metropole.
China ist im vielsinnigen Wortsinn gigantisch. Das Land ist 27mal so groß wie Deutschland. Und von mehr als 1,3 Mrd. Menschen bevölkert, das sind etwa 17mal so viele Einwohner wie bei uns. Somit ist es deutlich weniger dicht besiedelt. Die Metropolen Peking und Shanghai, die wir unter anderem besuchten, sind – neben Mexiko-City – die mit Abstand bevölkerungsreichsten Städte der Welt. Beide sollen aktuell weit über 20. Mio. Einwohner haben. Durch beide Städte haben wir uns zu Fuß, mit dem Auto und ab und an mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegt. Gerne wird in den deutschen Medien über den ständigen Verkehrskollaps berichtet, der in beiden Städten herrschen würde. Der mag dort vorkommen, aber seltener als in Berlin und München, wenn die maroden ÖVMs ausfallen oder deren Mitarbeiter streiken.

Vielmehr ist es weitaus beeindruckender, dass der Verkehr fließt, wenn auch manchmal zäh, und dass sich 20 Millionen Menschen tagtäglich durch die Stadt bewegen können, ohne dass es dabei zu chaotischen Verkehrsszenarios kommt. Zudem fahren in diesen Metropolen überwiegend Autos, die kaum älter als drei Jahre sind. Jedes Auto darf nur an bestimmten Tagen genutzt werden und um die Umweltbelastung nicht weiter zu erhöhen, gibt es sehr rigide Zulassungsregeln, die politisch völlig undenkbar bei uns wären. Auffällig zudem sind unendlich viele Elektroroller (auch auf dem Land), was den angenehmen Nebeneffekt hat, dass diese keinen Lärm machen. Nicht zuletzt gibt es unendlich viele, bezahlbare Taxis. Denn leider muss man ansonsten feststellen, dass die Preise für Konsumgüter und Dienstleistungen in den chinesischen Metropolen auf westeuropäischem Niveau angekommen sind – nur eben Taxifahren ist noch günstig. Um sich die Dimension noch einmal klar zu machen: in den Metropolen leben und arbeiten 4mal so viel Menschen wie im Ruhrgebiet. Und wer – wie ich – mal ein paar Jahre im größten Ballungsgebiet Deutschlands lebte, ahnt vielleicht, was mich hier so beeindruckt hat.
Doch nicht nur die Metropolen Chinas versetzten uns in Staunen. Auch in der chinesischen Provinz gibt es Projekte, die mich endgültig über den aktuellen Stand unserer Kompetenz für Großprojekte grübeln lassen. Doch wenn ich Provinz schreibe und dabei an den Besuch der Provinzstadt Hangzhou denke, dann spreche ich von einer 9 Mio. Stadt. Hier sind wir mit einem der Hochgeschwindigkeitszüge von Peking hingefahren. Nach gut 7 Stunden kamen wir ca. 1.300 km südlich an und fuhren einen Tag später vom derzeit zweitgrößten Bahnhof Chinas weiter nach Guilin.

Zunächst die eindrucksvolle Fahrt von Peking nach Hangzhou in einem chinesischen Hochgeschwindigkeitszug. Diese Strecke von 1300 km wird im 60 Minuten Takt befahren. 1300 km Wegstrecke entsprechen ungefähr der Autofahrt Hamburg – Florenz. Nach etwas mehr als 7 Stunden sind wir da, pünktlich. Durchweg fuhren wir fast immer 310 km/h und hielten an etwa 4 Stationen zwischendurch. Ich fahre in Deutschland sehr gerne Zug – auch lange Strecken von München nach Hamburg oder Berlin. Das sind dann immer gut 6 Stunden. Würde die Bahn da mal chinesisch Gas geben, wären es nur 3 Stunden. In China plant man demnächst die Geschwindigkeit auf 400 km/h zu erhöhen. So wird Bahnfahren richtig attraktiv.

Entsprach die Zugfahrt noch meinem Vorstellungsvermögen, so war ich dann beim Anblick des Bahnhofs von Hangzhou schier baff. Dieser zweitgrößte Bahnhof Chinas ist ein architektonisches Glanzstück – sowohl ästhetisch als auch in allen Belangen des Komforts. Ein solches Gebäude würde man eher als modernen Flughafen erwarten, denn als Bahnhof. Ein riesige Ankunfts- und Wartehalle. Unterhalb der Halle sind alle Gleise angelegt, zu denen man über zig Gates gelangt. An jedem Gate ist Personal, das den Check-In betreut, Auskunft gibt und einen freundlich verabschiedet. Es gibt auch kaum Gedränge, da man nur fest reservierte Plätze vergibt. Bei der Zugfrequenz ist das offenbar möglich. Auch wenn mir unser Hauptstadt-Bahnhof in Berlin gefällt, habe ich nicht vergessen, dass sich der damalige Bahnchef Mehdorn als geiziger Bauherr und selbstherrlicher Banause gerierte und gegen den Willen des Architekten das Bauwerk rechts und links stutzen liess.Wenn man nun diesen Bahnhof in der chinesischen Provinz gesehen hat, fragt man sich, wie provinziell sind wir in Deutschland eigentlich.
Als ich unserem Freund Yan erzählte, wie beeindruckt ich von China sei und wie peinlich derzeit in Deutschland sogenannte „Großprojekte“ wie der Flughafen Berlin, Stuttgart 21 oder die Oper in Hamburg verlaufen, wollte er mir das nicht glauben. Yan ist Deutschland nicht unbekannt. Er hat in Deutschland in den Neunzigern einige Jahre gearbeitet und gehört noch zu den Chinesen, die von der deutschen Arbeitsmoral, Kompetenz und Perfektion schwärmen. Doch wie lange noch?

Diese ersten Eindrücke von den gigantischen Dimensionen in China, die ja historisch betrachtet nur konsequent sind, wenn man – wie wir – auch den obligatorischen Besuch der Chinesischen Mauer einbezieht, werden beim Besuch von Shanghai nochmals gesteigert. Diese Stadt breitet sich nicht nur immens aus, sondern wächst auch sehr halsreckend in die Höhe. Und das nicht nur in einem Viertel sondern verschiedenen Bezirken. Die bekannte Skyline am Huangpu-Fluss ist da nur ein Distrikt von vielen, in denen Wolkenkratzer von über 150 m stehen. Derzeit sollen es 51 in Shanghai sein. Nur Hongkong hat noch ein paar mehr. Aber Chinas höchste stehen in Shanghai. Auf 472 m Höhe im Shanghai World Financial Center (Flaschenöffner-Architektur) haben wir uns die Stadt rundum angeschaut. In unmittelbarer Nachbarschaft des bislang höchsten Gebäudes in China steht nun auch die kurz vor der Fertigstellung stehende neue Superlative, der Shanghai Tower mit ca. 630 m.
Manch einer mag diese Hochhaus-Architektur als protzig und größenwahnsinnige Baukultur erachten, doch wer in China lebt, muss sie wohl oder übel ertragen lernen. Denn nicht nur Prestige heischende Bürotürme wachsen hier Jahr für Jahr, sondern auch unzählige Wohntürme mit über 50 Stockwerken. Und die gibt es nicht nur im Stadtgebiet der Metropolen. Sie stehen und entstehen gerade dutzendweise überall im Land, wie wir aus dem Zug oder Auto bei unseren Überlandtouren sehen konnten.

Zum schönen Abschluss unserer Reise gab es noch eine Einladung zum Essen bei Freunden in Shanghai, denen wir zuvor zwei perfekte Sightseeing-Tage verdanken.
Beide chinesischen Freunde, die wir in Peking und Shanghai besuchten, leben selbst in solch einem Wohnturm. Sie sind nicht vergleichbar mit den Hochhäusern bei uns, die wir überwiegend dem Boom der vergangenen 60er und 70er Jahre verdanken, als modernistisch heiß gelaufene Städteplaner mit mickrigen, vielstöckigen Sozialbauten Trabantenstadtviertel schufen, die heute meist soziale Brennpunkte sind. In China können dies sehr luxuriöse Anlagen sein, die nicht nur großräumige Maisonette-Wohnungen bieten, sondern auch schön angelegte Park, Pool- und Tennisanlage rundum haben.
So was hatte ich zuvor nur in Hongkong kennengelernt. Als wir dort Freunde besuchten, staunte ich bei der Fahrt in die 8stöckige Tiefgarage über den abgestellten Fuhrpark der Bewohner, der auf den ersten beiden Stockwerken unzählige Ferraris, Bentleys, Porsche und S-Klasse Mercedes umfasste. Umso weiter man nach unten fuhr, wurde es dann zwar etwas bescheidener, doch die Golf-Klasse war eine exotische Rarität. Auf ähnlichem Niveau bewegt sich heute Shanghai. In den Straßen sieht man – wie schon in Peking – kaum ein Auto, das älter als drei Jahre ist – ausgenommen Taxis. Doch hier sind die Karossen ausladender als in der Hauptstadt.

Die Stadt frönt – zumindest auf den ersten Blick – dem puren Luxus. Hedonisten sind hier im Schlaraffenland. Jedes Luxuslabel hat hier mindestens einen Flagshipstore, der gefühlt 4mal so groß ist wie in New York, London oder Paris. Es wird zwar sicher noch Jahre dauern bis Shanghai auch kreative, Trend gebende Metropole und modischer Impulsgeber wird – zumindest solange der westliche Geschmack noch bestimmend ist – doch sicher beeinflussen schon heute die Shopper in Shanghai immens, welches Label und welche Kollektion, welche Marke und welches Produkt in den kommenden Jahren hip sein wird.
Über den eigenwilligen „Style“ der modischen Frau in Shanghai schreib und zeig ich etwas im nächsten Teil so wie über manch andere Eigenarten in China die mir aufgefallen sind.

Wie man lesen konnte, habe ich meinen persönlichen Rückblick auf die vergangenen 14 Tage in China mit staunender Demut begonnen. Die gigantischen Herausforderungen, die dieses Land für mich auf den ersten und kurzen Eindruck hin mit Bravour meistert, hat mir einmal mehr gezeigt, in welches Dilemma wir hier in Westeuropa derzeit manövrieren: unser zunehmend saturierter, kleingeistiger Konservatismus, der dringend umzusetzende Projekte, gesellschaftliche Dynamik und technische Innovationen lähmt.
Wer solche von mir beschriebenen Eindrücke von China vorbehaltlos und ideologiefrei mitnimmt, ahnt, dass es auch in absehbarer Zeit keinen wirtschaftlichen Kollaps in China geben wird. Wer in China war oder dort lebt, sieht, dass es dort noch reichlich zu tun gibt und die Menschen danach gieren, es auch zu machen. Christian Y. Schmidt, den ich Anfangs als literarischen Reisebegleiter vorstellte, macht sich mit Recht über westliche Menetekel von irgendwelchen Wirtschaftsexperten lustig, die seit Jahren den asiatischen Infarkt prognostizieren. Dienen sie doch einzig als Augenwischerei und Selbstbeschwichtigung über die schwindende Agilität und Dynamik in unseren Luxusdemokratien. Es ist zu befürchten, dass wir irgendwann den Anschluss an die Moderne verlieren, wenn wir uns nicht an unsere langen Nasen fassen und uns fragen, wie wir zukünftig noch mit Leidenschaft, Tatkraft und mitreißender Begeisterung unsere Zukunft gestalten wollen.

Chinareise Teil 2